Wutanfälle und emotionale Intelligenz – nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen
Jeden Morgen gehen Sofka und ich gemeinsam zur Schule – durch ruhige Straßen unseres Vorortes.
Diese morgendliche Stille ist für uns essenziell, denn sie gehört uns: Wir nutzen sie, um in Ruhe miteinander zu sprechen.
Doch eines Morgens durchbrachen plötzlich übermenschlich klingende Schreie die Stille.
„Mama, was ist das?“, fragte mich Sofka erschrocken und ein wenig ängstlich.
Ich hatte keine Angst – ich erkannte jedes einzelne Geräusch. Nein, niemand wurde gefoltert, ausgeraubt oder gar umgebracht.
Es waren einfach die Schreie eines Kindes im Alter von etwa zwei bis fünf Jahren – ein klassischer Wutanfall.
Wenig später konnten wir die Geräusche auch einem Bild zuordnen: Aus einer Seitenstraße kam eine Mutter mit einem Buggy, den sie hastig vor sich herschob, und ihr Kleinkind, das lautstark schrie und versuchte, sich aus dem Wagen zu befreien.
Die Mutter hatte es wohl eilig, ihr Kind rechtzeitig in die Kita zu bringen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen.
Ich kenne diese Frau nicht persönlich, aber ich kenne sie trotzdem – ich kenne jeden ihrer Gedanken in diesem Moment, ihre Angst, ihre Verzweiflung.
Mit aller Kraft versuchte sie, nicht selbst loszuschreien, sondern weiterzugehen, das Kind im Wagen zu halten, das wie besessen tobte – ein mittelalterlicher Mönch hätte es vermutlich als „vom Teufel besessen“ beschrieben.
Wahrscheinlich hatte ich ein mildes Lächeln auf dem Gesicht, denn Sofka fragte mich gleich darauf: „Mama, was ist da los?“
„Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Alles ist gut. Der Junge kämpft nur gerade mit ganz vielen Gefühlen – er hat einen Wutanfall.“
„Was sind Wutanfälle, Mama? Klingt gefährlich.“
„Alle Kinder haben sie, wenn sie noch klein sind – bevor sie gelernt haben, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen und ihre Gefühle zu erkennen.“
„Gut, dass ich das nicht hatte“, meinte Sofka erleichtert.
„Oh doch, das hattest du. Und wie“, antwortete ich schmunzelnd.
„Wirklich?! Aber warum erinnere ich mich nicht daran?“, fragte sie erstaunt.
Und so war das Thema für unseren heutigen Schulweg gesetzt.
Warum haben Kinder eigentlich Wutanfälle?
Und warum, so scheint es, hatten wir in unserer Kindheit keine?
Ein Irrtum! Auch wir hatten Gefühle. Doch die Erziehung damals zwang uns, sie zu unterdrücken. Gefühle zeigen? Bloß nicht – was würden denn die Leute sagen! So sind wir groß geworden.
Deshalb wissen wir heute – mit über 30 – oft nicht, was wir eigentlich fühlen. Wir sind verwirrt. Ist das Wut oder Traurigkeit? Freude oder Nervosität? Wir haben keine emotionale Intelligenz entwickelt.
Unsere Kinder aber, die „Wutanfälle haben dürfen“, können schon mit unter zehn Jahren ihre Gefühle besser benennen und verarbeiten – ja, manchmal sogar besser als wir unsere.
Kinder lernen durch Vorbilder – und das sind wir: ihre Eltern.
Sie lernen nicht nur, was wir sagen, sondern vor allem, wie wir es sagen und wie wir selbst in schwierigen Situationen reagieren.
Wenn wir also selbst nicht wissen, wie wir mit Gefühlen umgehen, wie sollen es dann unsere Kinder lernen?
Kinder sind keine programmierbaren Maschinen, sondern kleine Menschen mit Gefühlen, die sie oft selbst nicht verstehen.
Unsere Verantwortung als Eltern ist nicht, dass sie sich „artig“ verhalten, sondern dass wir ihre Bedürfnisse erkennen und ihnen helfen, sie zu erfüllen.
Kälte und Autorität führen nicht zu emotional gesunden Menschen oder Beziehungen. Nur weil wir selbst so erzogen wurden, heißt das nicht, dass wir diesen Kreislauf nicht durchbrechen dürfen.
In unserer Kultur ist es tief verankert, zu denken: „Das Kind macht das nur, um mich zu provozieren.“ Und so drohen wir und bestrafen es, wenn es mit seinen Gefühlen kämpft – weil wir selbst dazu nicht in der Lage sind.
Wenn das Kind schreit, fragen wir nicht: Was fehlt ihm? Was braucht es? Sondern empfinden es als persönlichen Angriff auf unsere Autorität.
Aber Kinder handeln nicht aus Trotz.
Sie sind nicht böse. Oft ist unangemessenes Verhalten einfach ein Hilferuf – weil sie nicht wissen, wie sie unsere Aufmerksamkeit sonst bekommen sollen.
Der eigentliche Grund für Wutanfälle ist ganz einfach: Im Alter von 3 bis 5 erleben Kinder viele neue Gefühle, können sie aber noch nicht einordnen.
Wenn sich zu viele aufstauen, kommt es zur Explosion – zum Wutanfall. Und nein, schuld ist nicht der linke Socken am rechten Fuß oder zu viel Butter auf dem Brot. Das sind nur Auslöser – die Ursachen liegen tiefer.
„Wenn Kinder nicht den ganzen Wellen ihrer Gefühle Raum geben dürfen (ohne dass Erwachsene sagen ‚Beruhig dich!‘, ‚Das ist lächerlich!‘ oder ‚Du übertreibst!‘), dann lernen sie nie, Emotionen gesund zu verarbeiten. Stattdessen werden sie emotional unreife Erwachsene, die ihre Frustration an der Welt auslassen.“ (Robbins, S. 98)
In solchen Momenten ist es das Einfachste – weil wir selbst nicht weiterwissen – mitzuschreien. Aber das hilft niemandem, es macht alles schlimmer.
Und nein, auch wir Eltern sind nicht schuld. Wir wurden so geprägt: Ein schreiendes Kind gilt als schlecht erzogen, seine Eltern als unfähig. Wie oft hast du selbst das gedacht? Ich auch. Aber dann habe ich auf die harte Tour gelernt.
Das Schwierige an Wutanfällen ist: Sie lassen sich nicht planen.
Wenn sie zu Hause passieren, ist das fast schon ein Glück – denn dort kennt man sich aus. Man kann gefährliche Gegenstände aus dem Weg räumen, nah genug bleiben, um Verletzungen zu vermeiden – und das Wichtigste: sich selbst beruhigen.
Nicht reagieren, einfach warten, bis es vorbei ist. Schwer, aber notwendig.
Danach ist das Kind erschöpft – und wird von selbst zu dir kommen oder du zu ihm.
Dann heißt es: fest umarmen und sagen: „Alles ist gut. Mama/Papa ist da.“
Ich fragte Sofka immer: „Geht’s dir jetzt besser?“ Und sie seufzte: „Ja, viel besser.“
Jetzt ist Zeit für ein Gespräch.
Zusammen suchen wir nach dem Auslöser, benennen das Gefühl.
Nach einigen solchen Gesprächen sagte Sofka selbst: „Ich glaube, ich war einfach nur hungrig. Darf ich was essen?“ Oder: „Ich bin total müde.“
Warum ist unsere Ruhe entscheidend?
In erster Linie für unsere eigene Gesundheit – aber auch, um dem Kind zu zeigen: Alle Gefühle sind erlaubt. Ich bin für dich da. Ich liebe dich.
„Du lässt ihr aber viel durchgehen“, höre ich oft – von Menschen, die elterliche Gelassenheit als Schwäche sehen.
Ja, ich erlaube ihr, alle Gefühle zu haben.
Ich erlaube ihr, sich Hosen auszusuchen, die ihr angenehm sind. Ich verstehe, dass viele unser Verhalten nicht nachvollziehen können. Ich konnte es früher auch nicht – bis ich selbst Mutter wurde.
Theorie ist das eine, Realität das andere.
Sofka hat nicht geweint, weil sie verwöhnt war, sondern weil sie müde war, weil wir zu lange im Café saßen oder sie hungrig war. Und dann explodiert die Bombe – ohne Vorwarnung.
In solchen Momenten ist das Wichtigste: sich selbst beruhigen. Es geht nicht um dich – es geht um dein Kind.
Wenn du dich gesammelt hast, schütze dein Kind – räum mögliche Gefahren aus dem Weg. Denn es kann sich in dem Moment nicht selbst kontrollieren. Deine Aufgabe ist es, es zu beschützen – vielleicht mehr denn je.
Und wenn der Sturm vorbei ist – was er immer tut – nutze diesen Moment nicht, um deinem Frust Luft zu machen. Jetzt ist der Moment, deinem Kind zu zeigen: Ich bin da. Ich liebe dich. Ich bin dein sicherer Ort.
Denn das ist Elternsein – nicht nur lieben, sondern auch da sein. Worte sind oft leer. Aber eine Umarmung in schweren Momenten sagt mehr als tausend Versprechen.
Wutanfälle bei Erwachsenen?!
Das ist auch eine Erinnerung für uns Erwachsene: Gefühle zu unterdrücken ist nicht gesund – weder als Kind noch später. Auch Erwachsene haben Wutanfälle – weil sie das früher nicht durften. Mel Robbins widmet dem ein ganzes Kapitel in The Let Them Theory:
„Die meisten Erwachsenen sind eigentlich nur achtjährige Kinder in großen Körpern. Wenn dich jemand nervt – stell dir die Viertklässler-Version dieser Person vor. Du beschreibst jemanden mit der emotionalen Reife eines Achtjährigen. So sind die meisten Erwachsenen.“ (Robbins, S. 96)
Wie das aussieht?
Schlechter Tag im Büro, man kommt nach Hause, erzählt unter Tränen – und der Partner sagt: „Ist halt so – der Chef ist der Chef.“ Anstatt zu trösten, wird das Problem unter den Teppich gekehrt.
Warum? Weil niemand gelernt hat, wie man mit Gefühlen umgeht.
Emotionale Reife ist keine angeborene Eigenschaft – sie ist eine Fähigkeit. Und die muss man lernen.
„Emotionale Reife ist nichts, womit man geboren wird. Sie ist eine Fähigkeit, die Zeit, Übung und den Willen zu lernen erfordert.“ (Robbins, S. 97)
Stellt euch vor, wie viel einfacher das Leben wäre, wenn ihr von klein auf hättet sagen dürfen, was euch stört. Keine kratzigen Pullover. Keine Hosen, die zwicken. Keine elterlichen Machtspiele. Und vor allem: Man dürfte müde sein, Pausen brauchen, Nein sagen.
Wie viele „Spielchen“ in Beziehungen ließen sich vermeiden, wenn wir gelernt hätten, zu kommunizieren statt zu unterdrücken?
Deshalb ist es mir wichtig, dass mein Kind lernt, ihre Gefühle zu erkennen, auszudrücken und mir zu vertrauen. Dass sie sagt: „Ich brauche eine Pause vom Kindergarten.“ Oder: „Ich mag das Kleid nicht anziehen.“
Der größte Fehler wäre, sie zu etwas zu zwingen – das vermittelt: „Was du fühlst, zählt nicht. Was man von dir erwartet, ist wichtiger.“
Aber was sie stattdessen mitnimmt: „Ich bin nicht allein. Da ist jemand, der mich sieht und hört.“
Und dieses Gefühl – das ist unbezahlbar und bleibt ein Leben lang.
Herzlich,
S-Mama
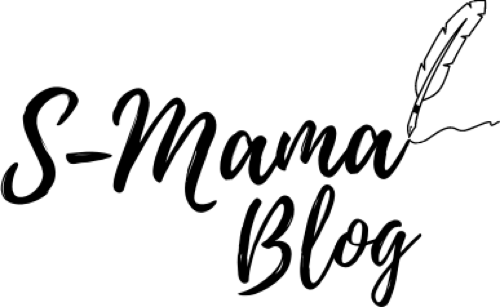






Leave A Comment